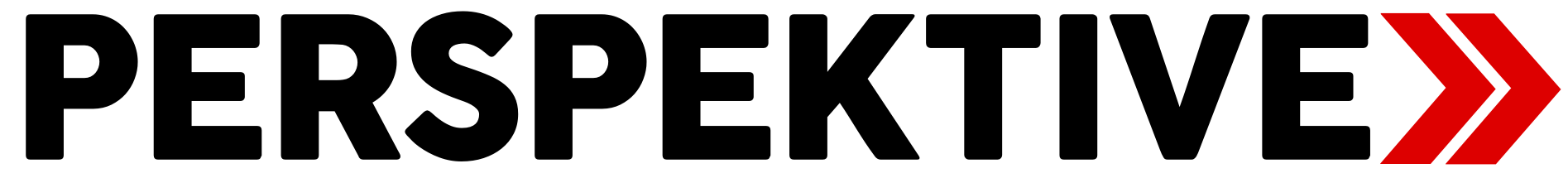Mario Draghi hat kurz vor seinem Abgang als EZB-Präsident eine erneute Zinssenkung und weitere Anleihekäufe verkündet. Was ist der Hintergrund dieser Politik, und kann sie auf Dauer gut gehen? – Ein Kommentar von Thomas Stark.
Mario Draghi schien am Donnerstag nicht gerade die Sonne aus dem Gesicht, als er vor die Presse trat. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte sich zuvor zur vorletzten geldpolitischen Sitzung unter seiner Führung versammelt, und Draghi hatte seinen Kurs nur gegen heftigen Widerstand durchsetzen können. Ein knappes Dutzend der 25 Ratsmitglieder sprach sich gegen Draghis Vorschläge aus, die der Rat am Ende ohne formelle Abstimmung beschloss: Der Einlagenzinssatz für Banken bei der EZB wurde von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent gesenkt. Zudem wird die EZB ihr umstrittenes Programm zum Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen ab November wieder aufnehmen. 20 Milliarden Euro sollen dafür pro Monat ausgegeben werden.
Was bedeuten diese Entscheidungen?
Die Europäische Zentralbank versorgt in ihrer Funktion als Bank der Geschäftsbanken im Euroraum die letzteren mit Notenbankgeld. Dies geschieht über verschiedene Arten von Geschäften: Zum Beispiel Kredite mit wöchentlicher Laufzeit, für welche die Geschäftsbanken Wertpapiere als Sicherheiten hinterlegen (hierfür gilt der auch als „Leitzins“ bezeichnete Satz von aktuell 0,0 Prozent). Der Einlagesatz, der nun weiter ins Negative gesenkt wurde, bestimmt wiederum, zu welchem Zinssatz Banken ihr überschüssiges Geld kurzfristig bei der Notenbank parken.
Das bedeutet: Hat eine Bank am Ende eines Geschäftstages Guthaben auf ihrem Konto bei der Notenbank, greift automatisch dieser Zinssatz. Jetzt, da er im negativen Bereich liegt, müssen Banken über Nacht also Strafzinsen bezahlen, wenn sie am Ende des Tages noch Geld übrighaben. Zwar hat die EZB zeitgleich mit ihrer Entscheidung Staffelbeträge eingeführt, sodass nicht jeder Geldbetrag mit dem Strafzins belegt wird. Die Grundlinie bleibt aber bestehen: Es wird mit diesem Zins ein erheblicher Anreiz für die Banken geschaffen, Strafzinsen zu vermeiden, indem sie noch mehr Kredite vergeben.
Was ist der Hintergrund dieser Politik?
Die Niedrigzinspolitik der EZB begann mit der Krise vor zehn Jahren. Eine Überproduktionskrise auf den Immobilienmärkten hatte zuvor das weltweite Finanzsystem an den Rand des Zusammenbruchs geführt. Im Zeitraum von 2008 bis 2009 senkte die EZB zeitgleich mit anderen Notenbanken in drastischen Schritten ihren Leitzins, von 4,25 auf 1 Prozent. In den Jahren danach, als eine Reihe von Staaten in der Eurozone in Schuldenkrisen gerieten (z.B. Griechenland, Spanien, Portugal, Irland, Italien), zog sie – nach einer kurzzeitigen kleinen Erhöhung – weiter nach und senkte den Leitzins bis März 2016 schließlich auf 0,0 %. Zwischen 2015 und 2018 kaufte sie außerdem Staats- und Unternehmensanleihen in einem Volumen von 2,5 Billionen Euro auf.
Die EZB hat in den letzten zehn Jahren also alles getan, um den Kredit in Europa weiter auszudehnen, und zwar ganz akut, um den Zusammenbruch der Eurozone aufgrund von Staatspleiten zu verhindern – und in der Hoffnung, die Industrieproduktion damit anzukurbeln. Eine wachsende Produktion würde sich dann in steigenden Preisen, dem berühmten Inflationsziel der EZB, niederschlagen. Das Problem ist: Einzelne Länder wie Deutschland haben zwar auf Kosten ihrer Nachbarstaaten ihre wirtschaftliche Position gestärkt. Die europäische Wirtschaft insgesamt ist durch die Krise von 2008/2009 aber in eine so schwere Depression geraten, dass die Industrieproduktion der Gesamt-EU erst im Jahr 2017 wieder ihr Vorkrisenniveau von 2008 erreicht hat.
Hinzu kommt: Die Ausweitung des Kredits geschah unter den Bedingungen eines ohnehin schon chronischen Überschusses von Leihkapital, der ein Merkmal des heutigen Weltkapitalismus ist. Dieser Überschuss von Leihkapital hatte in den 2000er Jahren dazu geführt, dass immer mehr Kapital auf der verzweifelten Suche nach gewinnbringenden Anlagen in die Immobilienmärkte strömte und dort die Überproduktion weiter anheizte. Jetzt führt er dazu, dass eine weitere Ausweitung des Kredits nur noch unter Inkaufnahme absurd niedriger Zinsen, bis hin zu Null- und Negativzinsen möglich ist.
Kann das auf Dauer gut gehen?
Bisher haben NotenbankerInnen und PolitikerInnen in Europa versucht, den Eindruck zu erwecken, dass sie einen klugen und nachhaltigen Plan verfolgen – dass sie wissen, was sie tun. Die öffentlich ausgetragenen, heftigen Interessenkonflikte zwischen den europäischen Staaten um die weitere Euro-Strategie widerlegt diesen Eindruck. In Wahrheit ist die EZB-Politik nämlich Ausdruck einer schweren Strukturkrise der europäischen Wirtschaft. Während die Notenbanken anderer Staaten (wie die amerikanische Fed) ihre Zinsen in der Aufschwungphase zwischenzeitlich erhöht hatten, ist die EZB mit ihren seit Jahren immer weiter nach unten gegangen.
Eine Geldpolitik, die eigentlich eine drastische Krisenpolitik ist, ist mittlerweile der Dauerzustand in der Eurozone. Deutschland hat andere Länder in den wirtschaftlichen Abgrund getrieben, um seine eigenen Exporte und damit die Industrie hierzulande zu steigern. Die Industrie in Gesamteuropa wurde aber nicht belebt. Dafür konnten sich zahlreiche europäische Unternehmen mit billigen Schulden über Wasser halten, die ansonsten pleite gegangen wären. Hierdurch haben sich nach Meinung von Branchenexperten in den Bilanzen der europäischen Banken bis heute „faule Kredite“ in Höhe von mehreren Billionen Euro angesammelt. Diese Ungleichgewichte werden früher oder später nach Bereinigung schreien.
Und die Lage der Weltwirtschaft ist nicht besser: Auf den Aktien- und Immobilienmärkten haben sich neue Spekulationsblasen gebildet und die Preise in die Höhe getrieben. Die nächste Wirtschaftskrise entwickelt sich gerade – und wirft die Frage auf, wie weit die Kreditausdehnung durch die Notenbanken noch getrieben werden kann, wenn die Zinsen teilweise schon bei null liegen. Das kann aber niemand wirklich beantworten, weil es eine vergleichbare Situation noch nicht gab.
Mario Draghis finsterer Blick ist vor diesem Hintergrund verständlich.