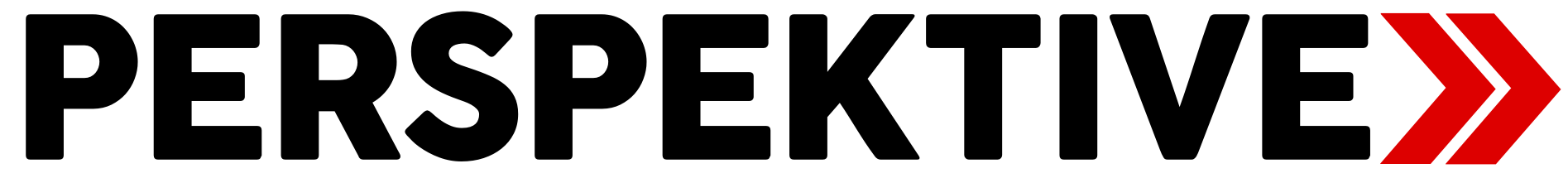In letzter Minute und pünktlich an Heiligabend haben sich die EU und das Vereinigte Königreich auf ein Post-Brexit-Abkommen geeinigt. Der Deal zeigt, dass Deutschland und Frankreich ihren britischen Konkurrenten unter Kontrolle behalten wollen. Der Einigung ging eine beispiellose Eskalation in den Verhandlungen voraus, Abriegelung der britischen Insel inklusive. – Ein Kommentar von Thomas Stark.
In den letzten Verhandlungswochen über den Brexit-Deal konnten wohl auch die naivsten Zeitzeug:innen lernen, was imperialistische Konkurrenz bedeutet: Erst brachte das Vereinigte Königreich den Einsatz seiner Kriegsmarine gegen Fischerboote aus der EU ins Spiel.
Dann nutzte Frankreich Meldungen über eine mutierte Version des Corona-Virus, um Großbritannien in einem bemerkenswerten Akt politischer Erpressung vom Güterverkehr mit dem europäischen Kontinent abzuriegeln. Dieser Rückgriff auf mittelalterliche Belagerungspraktiken brachte dann wohl den entscheidenden Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen: An Heiligabend präsentierten EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und UK-Premierminister Boris Johnson freudestrahlend ein 2.000 Seiten starkes Handelsabkommen.
Heiligabend im Mega-Stau: Brexit- und Corona-Chaos auf dem Rücken von LKW-Fahrer:innen
Einseitiger Freihandel
Wie bei EU-Deals üblich, enthält diese Vereinbarung zahlreiche Regeln mit zeitlicher Befristung und lässt viel Raum für Nachverhandlungen, sodass das Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich auch in den nächsten Jahren spannend bleiben dürfte. Bemerkenswert ist jedoch, wie stark die EU-Staaten ihren Konkurrenten mit dem Abkommen an die kurze Leine nehmen: Der Vertrag beschränkt den Freihandel zwischen dem Königreich und der EU nämlich weitgehend auf Industriegüter – von denen die EU weitaus mehr nach Großbritannien exportiert als umgekehrt.
Der Dienstleistungsbereich hingegen, der etwa 80 Prozent der britischen Wirtschaft ausmacht und bei dem die Handelsbilanz umgekehrt ausfällt, ist vom Freihandel weitgehend ausgenommen. Das bedeutet, dass britische Finanzunternehmen ihre Produkte ab dem 1. Januar erst einmal nicht mehr von London aus im EU-Binnenmarkt anbieten können, während deutsche und französische Industriefirmen ihre Waren weiterhin zoll- und beschränkungsfrei auf die Insel liefern können.
Souveränität mit Einschränkungen
Als gesichtswahrende Lösung hat das Vereinigte Königreich in Zukunft zwar die Freiheit, eigene Freihandelsverträge z.B. mit den USA oder den Staaten des britischen Commonwealth abzuschließen. Boris Johnson kann deshalb öffentlich damit prahlen, dass er die „nationale Souveränität“ seines Landes wiederhergestellt habe. Mit dieser Souveränität ist es jedoch bei näherem Hinsehen nicht weit her. Abkommen mit den USA oder den Commonwealth-Staaten dürften nach Einschätzung von Gabriel Felbermayr, Chef des Instituts für Weltwirtschafts (IfW), allenfalls ökonomische Schäden in Großbritannien mildern, die aufgrund des Brexit entstehen.
Aus der Sicht von Staaten wie Deutschland oder Frankreich ist viel wichtiger, dass dem Vereinigten Königreich bei der Festlegung von Produktstandards und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin die Hände gebunden bleiben – und damit auch seine Möglichkeiten, sich eigenständig Konkurrenzvorteile auf dem europäischen Markt zu verschaffen. Beide Seiten verpflichten sich mit dem Abkommen deshalb auf ein „gleiches Wettbewerbsumfeld“ („level playing field“) und richten einen eigenen bürokratischen Apparat ein, der dieses gewährleisten und zur Not Strafen verhängen soll. Die Freizügigkeit im Personenverkehr fällt ab 2021 weg: Wer im jeweils anderen Territorium arbeiten will, benötigt also in Zukunft ein Visum.
Geostrategische Eindämmung
Die EU hat zudem durchgesetzt, dass die inner-irische Grenze offenbleibt und die EU-Fischereiflotte noch fünfeinhalb Jahre (wenn auch mit Mengenbeschränkungen) in britischen Gewässern fischen darf. Hierbei geht es nicht nur um die Frage, wie viele Heringe, Dorsche oder Jakobsmuscheln französische Fischerboote vor der englischen Küste aus dem Wasser ziehen dürfen, sondern vor allem um die Festlegung, wer in Zukunft die Kontrolle über welche Regionen in der Nordsee und im Nordatlantik hat.
Mit der faktischen Beschränkung der britischen Souveränität über Nordirland und über das Meer schiebt die EU allen möglichen Ambitionen des Vereinigten Königreichs zu einer eigenständigen geostrategischen Expansion einen Riegel vor. Deutschland dürfte damit nicht zuletzt sein Ziel verfolgen, das Königreich in eine angestrebte engere Rüstungskooperation zu zwingen.
Sollte es in den nächsten Jahren zu weiteren größeren Konflikten zwischen dem Vereinigten Königreich und den EU-Staaten kommen, besitzen letztere zudem noch einen weiteren politischen Hebel, um ihre Interessen durchzusetzen: Das sind die Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland. Sollten diese eines Tages tatsächlich in die Tat umgesetzt werden, wäre das (dann nicht mehr vereinigte) Königreich endgültig zu einer Regionalmacht degradiert.
Deutschland und Frankreich haben mit dem Post-Brexit-Deal also ihren wichtigsten Konkurrenten in Europa in die Schranken gewiesen. Das Vereinigte Königreich hat die EU verlassen, damit aber seine ökonomische und geostrategische Position erheblich geschwächt. Wohl deshalb übte sich Ursula von der Leyen am Donnerstag in Süffisanz und zitierte Shakespeare: „So süß ist der Schmerz, wenn man sich trennt.“