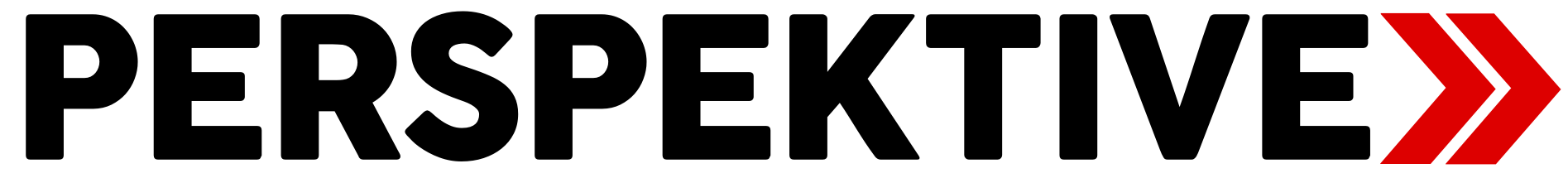Erfahrungen und Lehren aus dem Arbeitsalltag eines Uni-Mitarbeiters. Seit mehr als 10 Jahren arbeite ich an einer Universität in verschiedenen wissenschaftlichen Projekten. Vor kurzem stellte mein vorgesetzter Professor eine Bedingung an mich: Entweder ich höre auf, in meiner Freizeit politisch aktiv zu sein oder ich bekomme keinen neuen Arbeitsvertrag mehr. Was ich daraus gelernt habe – ein anonymer Erfahrungsbericht.
An allen Unis und in allen Fachbereichen gibt es ein stillschweigenden Abkommen: Die meiste Arbeit wird von uns Mitarbeiter:innen gemacht. Die Hoheit darüber, was in welcher Form gemacht und veröffentlich wird, haben aber die leitenden Professor:innen und die Post-Docs. Viele Mitarbeiter:innen nehmen das in Kauf, schließlich erhoffen sie sich eine steile Karriere und möchten irgendwann in die Positionen der Post-Docs und Professor:innen nachrücken.
Im Zuge dessen akzeptieren wir Mitarbeiter:innen auch schlechte Arbeitsbedingungen. Zum Teil wird uns zum Beispiel deutlich weniger Zeit bezahlt als wir eigentlich für die Arbeit aufwenden. Und viele Mitarbeiter:innen erhalten nur befristete Arbeitsverträge, oft über nur ein, zwei oder drei Jahre. Wollen wir an der Uni weiterarbeiten, müssen wir regelmäßig neue Gelder beantragen und neue Projekte an Land ziehen, im Klartext: Wir müssen uns unsere eigenen Arbeitsplätze schaffen. Jeder neue Antrag bedeutet dann auch, sich als Mitarbeiter:in sowohl dem eigenen Chef als auch den Geldgebern, oft staatliche Ministerien oder große Stiftungen, möglichst gut zu präsentieren.
Politischer Aktivismus unerwünscht
Genau so geht es mir seit einigen Wochen. Ich bin seit dem Herbst letzten Jahres arbeitslos, da ein Projekt, in dem ich gearbeitet habe, ausgelaufen war. Seitdem schreibe ich zusammen mit einem Professor, einem Post-Doc und einer weiteren Kollegin ohne Doktortitel an einem Antrag für neue Arbeitsplätze. Wir bewerben uns um eine staatliche Finanzierung für ein Projekt, in dem es im weitesten Sinne um Rassismus und Antirassismus in der Bildungsarbeit geht.
Vor einigen Tagen rief mich jedoch der Professor an und teilte mir unverblümt seine Forderung mit: Ich solle versprechen, mich nur auf das wissenschaftliche Projekt zu konzentrieren und in meiner Freizeit auf politischen Aktivismus zu verzichten. Ansonsten wolle er den Projektantrag auf keinen Fall unterschreiben. Dass das für den Antrag und die zukünftigen Arbeitsplätze des Postdocs, meiner Kollegin und mir wahrscheinlich das Aus bedeuten würde, war ihm gleichgültig. Für ihn sei, so sagte er, wichtiger nicht in die Schusslinie der Hochschul-Öffentlichkeit zu geraten. Er befürchte, dass mein politischer Aktivismus das Ministerium, die Uni-Leitung, seine Konkurrenten und vielleicht sogar die Medien gegen ihn als Projektleitenden aufbringen könne.
Bei Palästina hört der Spaß auf
Ganz konkret bezog sich der Professor auf ein Ereignis, das sich im letzten Jahr zugetragen hatte. Wir hatten zum Ende des letzten gemeinsamen Projektes die Veröffentlichung eines Sammelbands geplant. Zu den Autor:innen, die einen Beitrag zu diesem Band beisteuerten, gehörte auch ein Kollege aus einer anderen Stadt, mit dem ich nicht nur oft zusammen gearbeitet hatte, sondern mit dem ich auch befreundet bin. Eben dieser Kollege geriet letztes Jahr ins Kreuzfeuer einiger Politiker:innen und Journalist:innen: Er hatte an einer Demonstration in Solidarität mit dem palästinensischen Befreiungskampf teilgenommen, war dort erkannt worden und sogleich als “antisemitisch” verunglimpft worden.
Auch sein Beitrag in unserem Sammelband sollte deswegen kurzfristig gestrichen werden. Unser Professor befürchtete, dass auch er als antisemitisch gelten würde, wenn er nun mit dem besagten Kollegen in Verbindung gebracht werden würde. Dass zuvor gut zusammengearbeitet wurde? Dass die Positionen des Kollegen im wissenschaftlichen Kontext oft berechtigte Kritik an den bestehenden Verhältnissen übte? Dass die Palästina-Demo keineswegs “antisemitisch” war, sondern dort für einen gemeinsamen Aktivismus gegen den Imperialismus auf der ganzen Welt geworben wurde? Alles bedeutungslos, es zählte für meinen Professor nur noch die eigene Karriere.
Wenig später erfuhr ich darüber hinaus, dass der Professor nicht nur mit mir, sondern auch schon mit dem Post-Doc und meiner Kollegin telefoniert und sie über seine Forderung an mich informiert hatte. Die beiden hatten mich schnell als Schuldigen für das drohende vorzeitige Ende des neuen Projektes ausgemacht und unterstützten den Professor in seiner Forderung. Schließlich hatte ich mich im Herbst für einen solidarischen Umgang mit unserem diffamierten Kollegen eingesetzt und mich sogar dafür ausgesprochen, dass unser Sammelband doch wie geplant mit dem Beitrag des Kollegen erscheint. Nach einigen Hin und Her erschien das Buch mit dem Artikel, allerdings bestand unser Professor darauf, dass wir den Sammelband nicht bewerben.
Während für mich die Sache erledigt zu sein schien, fanden der Post-Doc und meine Kollegin aber nun, dass die neue Sorge des Professors durchaus richtig sein: Ich müsse nun nachweisen, dass ich wirklich loyal der Uni gegenüber sei und nicht meine eigenen politischen und die politischen Interessen meines befreundeten Kollegen vertrete.
Solidarität? Fehlanzeige!
In einem Streitgespräch mit dem Professor konnte ich deutlich machen, dass ich seine Forderung nicht nur nicht akzeptiere, sondern auch bereit bin, Schritte dagegen einzuleiten. Tatsächlich hat ihn meine Argumentation zum Einlenken gebracht: Er entschuldigte sich bei mir und stellte nun doch wieder eine Zusammenarbeit in Aussicht. Eine Garantie, dass er mich nicht mit anderen Mitteln dazu bringen will, mich von einem solidarischen Umgang mit Palästina-Aktivist:innen oder einem grundsätzlich kämpferischen Verhalten abzubringen, habe ich aber natürlich nicht.
Auch der Post-Doc und meine Kollegin haben zwar mittlerweile betont, dass sie gerne mit mir arbeiten wollen, aber ihr unsolidarisches Verhalten in dem Moment, als es darauf ankam, habe ich nicht vergessen. Der Post-Doc, mein zukünftiger Vorgesetzter, mit dem ich eigentlich ein freundschaftliches und kollegiales Verhältnis pflegte, riet mir sogar noch zu einer Therapie: Ja, er wolle gerne mit mir arbeiten, aber dann müsse ich mich auch “wieder auf die Reihe kriegen” und in die Lage kommen, gut mitzuarbeiten. Er kenne da eine gute Praxis, an die er mich vermitteln wolle.
Was ich daraus gelernt habe
Als Student und auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter habe ich die Universität oft als einen Ort idealisiert, an dem kritische Positionen Gehör finden. Wie viele andere war ich davon überzeugt, dass an den Unis das Wissen entsteht, mit dem unsere Gesellschaft zum Guten hin verändert werden kann. Ja, ich habe oft auch kritisiert, dass zum Beispiel unser Unirektorat enge Verbindungen zu einem Riesenkonzern pflegt und relativ offen wirtschaftliche Interessen in die Unipolitik hat einfließen lassen. Doch zumindest in unserem kleinen Team mit Professor, Post-Doc und Kollegin bildete ich mir ein, dass wir zusammenhalten und uns gegenseitig vertrauen.
Die Ereignisse jetzt haben mir gezeigt, dass ich zwar vielleicht weiter an der Uni weiterarbeiten kann – doch an der Uni geht es letztlich nicht darum, Kritik zu äußern oder gar die Gesellschaft zu verändern. Sondern es geht schlicht darum, die bestehende Ordnung und die bestehenden politischen Machtverhältnisse zu stützen. Während sich die anderen im vorauseilenden Gehorsam üben und nur ihr eigenes Weiterkommen innerhalb des Unisystems anvisieren, habe ich mir vorgenommen, mich von dem Druck nicht einschüchtern zu lassen. Ich möchte mich nicht in dieses System integrieren lassen. Lieber bin ich weiter politisch aktiv und schaffe selbst die Orte, an denen ich zusammen mit anderen für die Veränderung unserer Gesellschaft kämpfe. Und wenn die Uni ein Problem damit hat, dann werde ich mir einen neuen Job suchen.