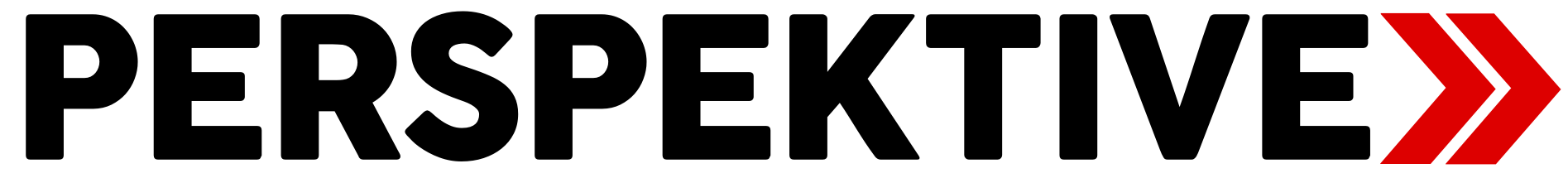Der ostdeutsche Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann und seine Thesen sind derzeit in aller Munde: Der Osten sei nur eine westdeutsche Erfindung zur Aufrechterhaltung der eigenen Vorherrschaft. An einer entscheidenden Stelle geht Oschmanns Analyse in die falsche Richtung. Eine Buchrezension von Mohannad Lamees.
Entstehung und Rezeption
Anfang 2022 veröffentlichte Dirk Oschmann in der FAZ einen Artikel unter dem Titel „Wie sich der Osten den Westen erfindet“. Aufgrund des Widerhalls im Feuilleton und zahlreichen Reaktionen erweiterte Oschmann seine Thesen und löste spätestens mit dem Erscheinen seines Bestsellers „Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ dieses Jahr eine Debatte über die Diskriminierung von Ostdeutschen aus.
Der Autor selbst ist Universitätsprofessor in Leipzig und schreibt aus einer Betroffenheitsperspektive. Aus ihm heraus strömte, so schreibt er selbst in der Wiedergabe der Entstehungsgeschichte seines viel gelesenen Artikels, „eine dreißigjährige Geschichte individueller und kollektiver Diffamierung, Diskreditierung, Verhöhnung und eiskalter Ausbootung“. Daran schreibt Oschmann mit einer gehörigen Portion Wut an.
Diskursanalyse: Westen vs. Osten
Tatsächlich gelingt es dem Literaturwissenschaftler Oschmann gut, seine eigene Biographie mit seinen generellen Beobachtungen des Verhältnisses von West- und Ostdeutschland zu verweben. Sein Buch ist eine anekdotenreiche Streitschrift, für die der Professor ein ganzes Arsenal an diskurswissenschaftlichen Begriffen und Ideen aufbietet.
Die Kernthese lautet, wie der Titel des Buches vorgibt, dass die Idee von „Ostdeutschland“ eine Konstruktion des Westens sei. Auf „den Osten“ projiziere der Westen alle seine eigenen Probleme du eine Vielzahl von negativen Zuschreibungen und Assoziationen. Der Osten, so Oschmann, werde im Westen und in den westdeutsch dominierten Medien stets als rückständig, dumm, faul oder demokratiefeindlich dargestellt. Es ist diese Gegenüberstellung, die Oschmann anprangert: Der Westen schaffe so eine Vorstellung, dass der westdeutsche Teil des Landes normal und gesund, der ostdeutsche Teil aber abnormal und krank sei. Für den Autor ist klar, dass es sich bei dieser Identitätszuweisung um ein „Herrschaftsspiel“ handelt und der Westen sich so seine Überlegenheit sichert.
Dementsprechend seziert Oschmann diese Ungleichheit zwischen Ost und West: Er kritisiert, dass nach der Wiedervereinigung keine gemeinsame Hymne, geschweige denn eine gemeinsame Verfassung verhandelt wurden. Stattdessen gelte damals wie heute einzig und allein die BRD als Maßstab, Ostdeutschland hingegen solle sich anpassen und unterordnen. Dass zu diesem ständigen Gegensatz auch einiges an westdeutscher Heuchelei und Doppelmoral gehört, illustriert der Professor mit einigen Beispielen: Dialekt, Doping im Sport und Nazis seien schließlich keine Dinge, die es nur im Osten gebe.
Nur der Ostdeutsche, nicht aber der Westdeutsche, stehe im „Modus der Daueraffirmation“ – gemeint ist damit, dass Ostdeutsche ständig als Ostdeutsche gesehen und angesprochen werden. Oschmann selbst ist davon deutlich genervt und stellt mehrmals klar, dass er diese „ostdeutsche Identität“ nicht zugewiesen bekommen möchte.
Hier zeigt sich mehr als deutlich das Labyrinth der Identitätspolitik, in das sich Oschmann, immerhin sehr bedacht und vorsichtig, hineinwagt: Einerseits postuliert der Uniprofessor immer wieder seine ostdeutsche Herkunft und beklagt an einer Stelle gar, dass es in Ostdeutschland eine Quote für ostdeutsche Professor:innen geben sollte. Andererseits nimmt er für sich in Anspruch, eine „Des-Identifizierung“ vorzunehmen und sich dagegen zu wehren, dass Ostdeutsche von Politik und Medien eine Ost-Identität auferlegt bekommen.
Koloniale Kontinuitäten in Ostdeutschland
Oschmanns Argumentation lässt die naheliegende Vermutung zu, dass der Professor mit dem Werk „Orientalismus“ seines Fachkollegen Edward Said durchaus vertraut ist und sich einiges abgeschaut hat. Analysierte Said in seinem post-kolonialen Klassiker, wie sich der Westen den „Orient“ und den Nahen Osten zusammen fantasiere, so bezieht sich Oschmann nun auf den besonders nahen Osten.
Oschmann, das wird in seinem Buch deutlich, kennt sich auch über diese Parallele hinaus bestens aus mit dem gegenwärtigen post-kolonialen akademischem Duktus. Deutlich wird das zum Beispiel in seiner Analyse zur kolonialen Symbolpolitik in der Architektur des neuen Humboldtforum in Berlin oder wenn er eine Verbindung zwischen Ostdeutschland und den deutschen afrikanischen Kolonien zieht: „Die fürstlichen Sonderzahlungen“ für alle westdeutschen Beamt:innen, die nach der Wende in den Osten gingen, wurden auch als „Buschzulage“ bezeichnet. Und dieses Wort stamme, so Oschmann, aus der deutschen Kolonialzeit und war eine Bezeichnung für die Zulage für kaiserlich-deutsche Beamt:innen, die in die deutschen Kolonien in Afrika gesandt wurden.
Nicht nur in solchen einzelnen Beispielen, sondern generell erkennt der Autor eine koloniale Kontinuität: so wie der Westen früher seine Kolonialisierung mit einer Zivilisiertheit begründet habe, so begründet Westdeutschland heute die Vorherrschaft über Ostdeutschland mit der Demokratiefeindlichkeit der Ostdeutschen. Das nennt Oschmann eine „maximale terminologische Deklassierung“ und ein „durch und durch negativ aufgeladenes, imperiales Bild-, Begriffs- und Assoziationsfeld“
An anderer Stelle zieht der Literaturwissenschaftler auch eine Verbindung zur Nazi-Propaganda über Osteuropa und die Darstellung des Ostens als das Barbarische und Unkultivierte. Die Terminologie „Aufbau Ost“, die sich nach der Wende eingebürgert hatte, stamme direkt aus der Nazizeit und bezeichnete ursprünglich den Willen, Osteuropa zu unterwerfen.
Oschmanns Sackgasse: Streben nach Anerkennung statt tiefergehender Analyse
Egal wie detail- und facettenreich Oschmann seine Argumente ausführt: Schlussendlich führt er seine Leser:innen in eine Sackgasse. Denn der Professor schreibt zwar ansprechend und wortgewandt. Er dringt aber nicht zum eigentlichen Wesen dieses westdeutschen Nationalismus vor und schafft es nicht, die Lage in Ostdeutschland in ihrem Gesamtkontext zu analysieren. So wie viele andere bürgerliche Poststrukturalist:innen, Rassismusforscher:innen und Gender Studies-Expert:innen gelingt es Oschmann nicht, die wichtigen weiterführenden Fragen zu stellen: Wer profitiert tatsächlich von dieser Abwertung Ostdeutschlands?
Allein dass der Autor die BRD, das dritte Reich und das deutsche Kaiserreich über die ähnlich verwendete Sprache in Bezug zueinander setzt, ist noch keine fertige Analyse. Konsequent wäre es hier zu fragen, was die BRD, die Nazis und das deutsche Kaiserreich für gemeinsame Interessen hatten. Doch die Antwort auf diese Frage und eine eindeutige Nennung des deutschen Imperialismus, also dem Streben des deutschen Finanzkapitals nach Profit durch Ausdehnung des Einfluss- und Machtbereiches, findet sich bei Oschmann nicht.
Denn eine solche Antwort würde den Uniprofessor gehörig in die Bredouille bringen. Schließlich ist Oschmann angetreten, für mehr ostdeutsche Teilhabe und Mitbestimmung am großen Ganzen zu werben. Beschriebe er nun das große Ganze als Imperialismus mit unnachgiebigem Expansionsdrang, was würde das über ihn aussagen, der sich immer wieder auch über seine persönliche Ausgrenzung beschwert und einfordert, mitmachen zu dürfen?
Dementsprechend bleibt Oschmann, so wie unter kleinbürgerlichen Akademiker:innen üblich, bei einer oberflächlichen Betrachtungsweise stehen. Er redet sich und seinen Leser:innen ein, dass mehr ostdeutsche Teilhabe und Repräsentation automatisch für ein Ende der Abwertung und Ausgrenzung sorgen würden. Dabei liefert er die Gegenargumente bereits selbst: Der deutsche Imperialismus wird, solange er als System grundsätzlich bestehen bleibt und nicht gestürzt wird, immer wieder neue Ablehnungen gegen andere Volksgruppen und Regionen vorbringen – je nachdem, was gerade im Interesse der herrschenden Kapitalistenklasse ist.
Die Befreiung Ostdeutschlands kann nur das Werk der Arbeiter:innen sein
Genau hier führt uns Oschmann in die Irre: Für ihn stellt der Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland die Differenzlinie dar. Zwar beschreibt er „den Osten“ als machtlos und arm und benennt auch die existierenden Lohnunterschiede zwischen Ost und West. Seine Erklärung ist aber immer die Unterwerfungswut des Westens: „Der Westen“ schaffe „einen großen Teil seines Reichtums seit Langem damit, dass er sich die historische Benachteiligung Osteuropas und anderer Weltgebiete schamlos zunutze macht, wobei er gleichzeitig noch vorgibt, etwas Gutes zu tun“ – Oschmann versucht hier, das Ausbeutungsverhältnis deutlich zu machen – doch weil er vom „Westen“ anstatt präziser von westdeutschen Kapitalist:innen spricht, verwischt er letztendlich eine klassenbewusste Perspektive auf die Unterdrückung Ostdeutschlands und verliert sich in plumper nationaler Rhetorik. Klasse ist für den Professor an Herkunft gebunden.
Das ist ein Fehler. Schließlich spielt Oschmann so westdeutsche Arbeiter:innen und ostdeutsche Arbeiter:innen gegeneinander aus. Eben weil er den Hauptfeind, den deutschen Imperialismus und die deutschen Großkonzerne, nicht klar benennt, stellt er ost- und westdeutsche Klassengeschwister nun sich selbst als Feinde gegenüber. Doch nur alle deutschen Arbeiter:innen gemeinsam können die deutschen Kapitalist:innen entmachten und ein System errichten, indem ihre Interessen, ihre Teilhabe, ihre Würde gesichert ist.
Die Streiks in Riesa und Beeskow, bei denen ostdeutsche Arbeiter:innen einen Angleich ihrer Löhne an westdeutsches Niveau forderten, zeigen uns bereits heute im Ansatz, wie der Kampf für ein Ende der Ausbeutung in Ostdeutschland aussehen muss: Gezielt gegen die Bedingungen in Ost-Deutschland gerichtet, aber verbündet mit den westdeutschen Kolleg:innen gegen die gemeinsamen Chefs. Warum sollten sich diese Arbeiter:innen den „Westdeutschen“ an sich zum Feind nehmen und sich womöglich sogar von den Faschist:innen ködern lassen, die eben dieses Feindbild gerade im Osten immer weiter kultivieren? Nein, es braucht keine Gräben zwischen Ost und West, sondern zwischen Arbeiter:innen und Kapitalist:innen, zwischen oben und unten.
Dirk Oschmann: „Der Osten: eine westdeutsche Erfindung“, Ullstein Verlag.