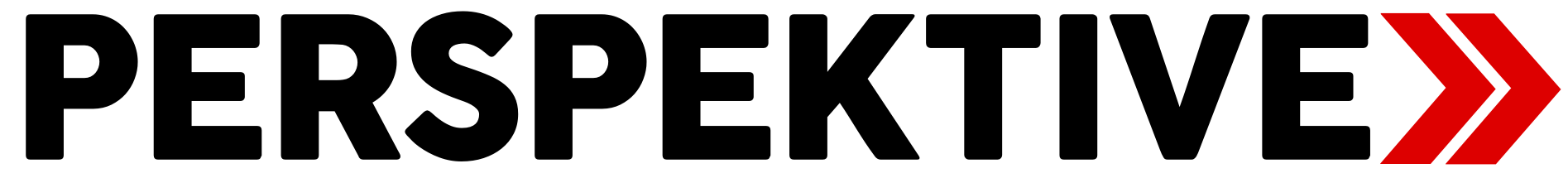2004 begann eine Protestwelle in ganz Deutschland. Anknüpfend an die Bürgerrechtsbewegung der DDR demonstrierten montags regelmäßig Arbeiter:innen und Arbeitslose gemeinsam gegen die Einführung von Hartz IV durch die rot-grüne Regierung. Ihr Kampf ist heute aktueller denn je. – Ein Kommentar von Jens Ackerhof.
Wer politisch aktiv ist und bereits einige Kundgebungen und Demonstrationen hinter sich hat, wird mit der Resignation vieler Menschen vertraut sein: „Warum auf die Straße gehen? Es ändert sich doch sowieso nichts“, bekommt man dann von Passant:innen, Freund:innen, oder Familie zu hören. Verständlich ist diese Haltung durchaus – dass Proteste konkrete und weitreichende politische Ziele durchsetzen, ist (noch) eher die Ausnahme.
Auch die Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV, die heute vor 20 Jahren ins Leben gerufen wurden, konnten ihr Ziel nicht erreichen. Die rot-grüne Regierung setzte ihre Agenda 2010 trotz Massenprotesten um. Und auch, wenn heute Bürgergeld statt Hartz IV bezogen wird, hat sich damit die Lage von Arbeitslosen kaum verbessert. Teilweise drohen ihnen sogar zusätzliche Sanktionen. Waren die Proteste, die 2004 ihren Höhepunkt fanden also sinnlos? Ganz im Gegenteil! Wir können heute viel von ihnen lernen.
Die 2000er – Arbeitslosigkeit, schwache Konjunktur, Globalisierung
Zunächst ist es sinnvoll, sich den sozialen und wirtschaftlichen Kontext anzuschauen, aus dem die Montagsdemos hervorgegangen sind. Nach der Wiedervereinigung profitierten vor allem westdeutsche Kapitalist:innen von dem Verscherbeln der ehemals staatlichen ostdeutschen Betriebe. Nach einem starken Wirtschaftswachstum in den Jahren 1990 und 1991 ging jedoch die Konjunktur bergab.
Bereits vor der sogenannten Finanzkrise 2009 kam es zu drei Rezessionen. Auch die offiziellen Arbeitslosenzahlen stiegen ab 1991 stetig an und erreichten 2005 mit 13 Prozent einen Höhepunkt. Bis heute sind sie in Ostdeutschland höher als im Westen. In den 2000ern war dieser Unterschied besonders gravierend – oftmals war die Arbeitslosenquote im Osten doppelt so hoch.
Auch nahm in dieser Zeit die Globalisierung Fahrt auf. Damit ging nicht nur eine verstärkte Ausbeutung unterentwickelter Länder einher, sondern auch eine Gefahr für Teile der deutschen Arbeiter:innenklasse: 2004 verlegte beispielsweise Siemens 2.000 Arbeitsplätze ins Ausland. Viele Menschen sahen berechtigterweise ihren Arbeitsplatz gefährdet und in ein Niedriglohnland verlegt zu werden. Was aber nicht heißt, dass Arbeiter:innen in der BRD gerechten Lohn erhielten. Ab 1996 sanken die Reallöhne, während die Verbrauchspreise bis heute kontinuierlich steigen.
Agenda 2010
Behalten wir diesen sozio-ökonomischen Kontext im Hinterkopf, so können wir uns wohl gut ausmalen, was viele Arbeiter:innen und Arbeitslose gedacht haben mussten, als Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) 2003 im Bundestag verkündete: „Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem einzelnen abfordern müssen”. Mit diesen Worten stellte er die Agenda 2010 vor, ein Reformpaket für Arbeitsmarkt und Sozialsystem.
Und ein klarer Angriff auf die Arbeiter:innenklasse. Das an Einkommen gekoppelte Arbeitslosengeld sollte nur noch maximal 12 Monate ausgezahlt werden. Danach kam das Arbeitslosengeld II (Hartz-IV), das nur noch die Grundbedürfnisse und ein Mindestmaß an sozialer Teilhabe sichern sollte. Ein niedriger Standard, der für viele Arbeitslose bis heute noch nicht einmal erfüllt wird. Arbeitslose durften von nun an kein Vermögen über einer gewissen Grenze besitzen und mussten dafür sogar die Sparbücher ihrer Kinder offenlegen.
Außerdem wurden Arbeitslose von nun an in prekäre Jobs gezwungen, für die sie häufig überqualifiziert waren. Lehnten sie diese ab, würden ihre Bezüge um 30 Prozent gekürzt.
Anfang der Montagsproteste
Kleinere Demonstrationen gegen den Sozialabbau fanden bereits 2003 statt, oftmals veranstaltet von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD). Einzelne Großdemonstrationen wurden am 1. November 2003 und am 3. April 2004 in Berlin durchgeführt, jeweils mit 100.000 bzw. 250.000 Protestierenden. Doch als im Juli 2004 Formulare für das im kommenden Jahr geltende Hartz-IV verschickt wurden, war dies der Startschuss für die regelmäßigen Montagsdemos.
Initiator war der mittlerweile verstorbene Andreas Ehrholdt, selbst trotz jahrelanger Jobsuche arbeitslos. 600 Leute erschienen bei der von ihm angemeldeten Demo in Magdeburg. Das Motto: „Schluss mit Hartz IV, denn heute wir und morgen ihr“. Ein klug gewähltes Motto, das sich gegen der Spaltung in Arbeitende und Arbeitslose richtete. Dies schlug sich, vor allem in Ostdeutschland, auch in der sozialen Zusammensetzung der Teilnehmenden nieder: Nicht nur Arbeitslose gingen auf die Straße, sondern auch jene, die einen Absturz in die Arbeitslosigkeit fürchteten. Manchen Einschätzungen zufolge war letztere Gruppe bei den Protesten sogar überrepräsentiert.
Die Demos waren besonders in ihrer Anfangszeit eine wirkliche Graswurzel-Bewegung. Menschen mit teilweise sehr unterschiedlichen Überzeugungen und Lebenslagen gingen gemeinsam und kämpferisch auf die Straße, viele sogar das erste Mal. Sie prägten die Proteste mehr als Parteien oder Gewerkschaften. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützte die Proteste ohnehin nie.
Bald entfachten Montagsdemos ganz Deutschland: Hamburg war am 9. August 2004 eine der ersten westdeutschen Städte, die das Konzept aufgriff. Die Demos hatten jedoch in Ostdeutschland weitaus größeren Zulauf. Beispielsweise gingen in Leipzig zum Höhepunkt der Montagsdemos im August 2004 30.000 Menschen auf die Straße, während es in Dortmund nur 1.500 waren. Dennoch war der Protest weit gestreut, sodass sich Ende August insgesamt 200.000 Menschen in 220 Städten beteiligt hatten.
Unterschied zwischen Ost und West
Die ost- und westdeutschen Demos unterschieden sich jedoch nicht nur in ihrer Anzahl: In Westdeutschland waren es vor allem politische Organisationen, welche die Proteste prägten und zum Teil führten, beispielsweise die reformistische Attac, oder die Kleinstpartei MLPD. In Ostdeutschland waren die Demos weit weniger von Organisationen geprägt.
Diese größere Spontanität und Unerfahrenheit der Teilnehmenden könnte auch dazu beigetragen haben, dass eine Minderheit an Neonazis in manchen Städten – teils unbehelligt – mitmischen konnte. So war in Köthen (Sachsen-Anhalt) ein Demonstrant mit Hakenkreuz-Tattoo zu sehen, und in Magdeburg stürmten 100 Neonazis an die Spitze der Demo. Dass Rechte auf zynische Weise soziale Proteste unterwandern, kommt heute noch genau so vor – ob bei den Anti-Lockdown-Protesten während der Pandemie, Antikriegsdemos oder den jüngsten Bauernprotesten.
Gegen das Establishment? – Wie die AfD ihr bürgerliches Profil schärft
Diffamierung durch die bürgerliche Politik
Auch wenn Rechte die Minderheit bei den Demos ausmachten, nutzten die bürgerlichen Parteien dies nur allzu gerne, um die Demos zu diffamieren. Besonders entrüstet zeigten sich viele schon von der Verwendung des Konzepts der Montagsdemonstration. Dieses geht auf die Bürgerrechtsbewegung der DDR zurück, in der 1989 und 1990 regelmäßig Montagsdemos gegen die undemokratische SED-Herrschaft stattfanden.
Natürlich ist und war das System der BRD genauso undemokratisch wie das der DDR. Die bürgerliche Politik zeigte sich durch den Vergleich jedoch entrüstet: „töricht und geschichtsvergessen“ (Joachim Gauck) oder „Zumutung und Beleidigung“ (Wolfgang Clement, SPD) schimpften sie. Entgegen dieser Narrative befürworteten und verteidigten hingegen Angehörige ehemaliger DDR-Oppositionsgruppen die Montagsdemos.
Rückgang der Teilnahme und Spaltung
Bereits im Oktober 2004 nahm die Teilnahme an den Demos drastisch ab, in manchen Städten fanden sie gar nicht mehr statt. Ein kleiner harter Kern führte die regelmäßigen Proteste dennoch (zum Teil sogar bis heute) weiter. 2006 veröffentliche Der Spiegel einen Artikel über diesen harten Kern. Einerseits wird darin die persönliche Betroffenheit und das Durchhaltevermögen der Demonstrierenden gut vermittelt. Andererseits stellt der Artikel den andauernden politischen Kampf als bloße Selbst-Bespaßung der Teilnehmenden dar: „Ilona Ehrhard kommt mal raus. Hans Haase kann Dampf ablassen. Tom Hübschmann hat ein Alibi. Und Fred Schirrmacher bleibt in glücklicher Opposition“, hieß es dort überheblich.
Wenn wir nach Gründen für den Rückgang der Proteste suchen, lässt sich zunächst sagen, dass fast alle spontanen Bewegungen früher oder später „ausläppern“ – ob die Occupy-Proteste oder die jüngsten Anti-AfD-Proteste, die trotz Rekordteilnahme mittlerweile kaum noch stattfinden. Für nachhaltige Veränderung oder dauerhaft hohe Beteiligung braucht es Klarheit und Einigkeit in den politischen Mitteln und Zielen, und ein hohes Maß an Organisiertheit, das in spontanen Bewegungen kaum vorhanden sein kann.
Was wir aus den Montagsdemos lernen können
Obwohl die Proteste abflauten und ihr Ziel nicht erreichen konnten, haben sie dennoch Erfolge zu verzeichnen: Viele Menschen gingen zum ersten Mal kämpfend auf die Straße. Sie vernetzten sich untereinander und merkten, dass – egal wie unterschiedlich ihre Mitstreiter:innen vielleicht auch sein mögen – ihre Interessen die gleichen sind. Anstatt dass nur wenige Großdemos in Großstädten organisiert wurden, wurde die Widerstand gegen Hartz IV auch in die Kleinstädte getragen.
Und auch wenn Der Spiegel auf die andauernden Kleindemos nach 2004 mit Belustigung herabschaut, können wir uns an ihnen durchaus ein Beispiel nehmen. Denn wenn man auf einer 70-Leute Demonstration erhellende Diskussionen führt und bislang unpolitische Menschen für den Klassenkampf begeistert, kann das manchmal erfolgreicher sein als eine 100.000 Teilnehmer-starke „Latsch-Demo”.
Klammheimlich zurück zu Hartz IV – Wie die “Wachstumsinitiative” das Bürgergeld verstümmelt
Fazit: Das Bürgergeld löst die Probleme der Arbeiter:innen und Arbeitslosen nicht und könnte ohnehin sehr einfach wieder abgeschafft werden. Der Kampf von Andreas Erholdt und seinen Mitstreiter:innen ist heute also genauso relevant, wie vor zwanzig Jahren. Sozialistische Organisationen sollten diesen Kampf wieder aufnehmen und mit Konsequenz und Ausdauer führen. Dabei sollten sie zwar nicht undemokratisch oder gar sektiererisch agieren. Dennoch sollte es ihr Anspruch sein, die spontane Bewegung mit anzuführen und sicherstellen, dass es nicht um faule Kompromisse geht – sondern ums Ganze!