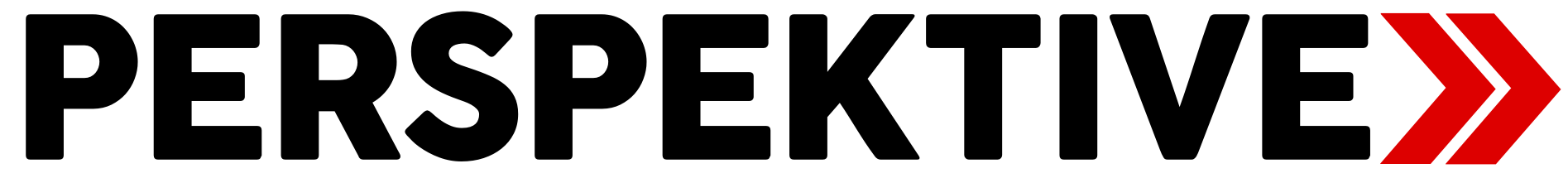Eine Filmkritik zu Damien Chazelles Drama „Aufbruch zum Mond“ – von Pa Shan
In den 1960er Jahren konkurrierten die zwei Supermächte USA und Sowjetunion auch um die Beherrschung der Raumfahrt. 1961 beeindruckte der Russe Juri Gagarin den Planeten als erster Mensch im Weltraum. 1969 bewiesen die USA mit dem Betreten des Mondes durch Neil Armstrong, dass sie über das größere Kapital verfügten. Damien Chazelles dokumentarisches Spielfilmdrama (2018) mit Ryan Gosling in der Hauptrolle stellt dieses Ringen der Supermächte aus der Perspektive Neil Armstrongs dar.
Die Heldengeschichte als Leidensgeschichte
Überraschenderweise erscheint der Hauptprotagonist keineswegs wie der strahlende Held, als der er uns immer präsentiert wurde. Die Stilisierung Neil Armstrongs zum kühnen Vorreiter des menschlichen Fortschritts kommt in dem Film praktisch nicht vor und wird nur angedeutet, wenn die ZuschauerInnen hier und da den heimlichtuerischen und manipulativen Umgang der NASA mit der Öffentlichkeit erleben. Weder die NASA noch die Raumfahrer erscheinen als heroisch. Im Gegenteil: Ryan Gosling wird in der Rolle Armstrongs höchstens zum gebrochenen Helden. Eher noch spielt er einen gewöhnlichen Familienvater, dessen Familienleben unter den Anforderungen seines Berufs leidet.
Das Leiden Armstrongs unter seinen beruflichen Ansprüchen ist ohnehin das dominierende Motiv des Films. Schon die erste Szene löst Beklemmung und Verunsicherung aus: Armstrong rast in seinem Düsenjäger mit unfassbarer Geschwindigkeit in Richtung Weltall. Das Flugzeug rattert und droht, jeden Moment auseinander zu brechen, bis es endlich die Erdatmosphäre durchbricht.
Es folgen einige Momente absoluter Stille im All. Armstrong genießt diese ruhigen Sekunden bis er wieder in den Sinkflug gerät. Doch anstatt dass es planmäßig absteigt, prallt das Flugzeug an der Atmosphäre ab, und der Tod im Weltall droht für einen Augenblick. Nur mit Mühe gelingt es dem Piloten, wieder wie geplant abzusinken. Der Düsenjäger scheint vor Schmerzen zu kreischen, die schneidenden Winde geben dämonische Schreie von sich.
Unterordnung unter unmenschliche Anforderungen
Als nächstes erleben wir die Beerdigung der kleinen Tochter von Armstrong. Nach außen gibt sich dieser unberührt und geradezu emotionslos. Aber wir sehen, dass ihn der plötzliche Tod des Mädchens unerträglich peinigt und er in bitterste Tränen ausbricht – wohlgemerkt, nachdem er die Vorhänge seines Zimmers zugezogen hat. Über seine Gefühle spricht unser Protagonist nicht. Wenn es um das Zwischenmenschliche geht, ist er geradezu wortkarg. Auch die vielen tödlichen Unfälle seiner Kollegen nimmt er scheinbar stoisch hin.
Aber wir wissen, dass der Pilot sich schlicht nach besten Kräften bemüht, sich den unmenschlichen Anforderungen der Raumfahrt unterzuordnen. Und dies gelingt ihm ausgezeichnet. Nur ausnahmsweise zeigt er seine menschliche Seite, etwa, wenn er abends mit den Kollegen doch noch ein Bier trinken geht oder wenn er mit den Söhnen Fangen spielt. Die Raumfahrer leiden ebenso wie ihre Angehörigen, und sie sind ebenso gewöhnliche Menschen, die ebensolche Ängste und Unsicherheiten verspüren.
Der Film veranschaulicht das immer wieder sehr plastisch: Die Gemini 8-Raumkapsel, die Armstrong besteigt, wirkt z.B. wie ein metallischer Sarkophag, in dem zwei elektrische Stühle eingebaut sind. Die beiden Astronauten werden an den Stühlen festgeschnallt, so, als ob man ihnen die Flucht verwehre. Das Raumfahrerfrühstück wirkt wie ein Henkersmahl. Die körperlichen Tests und Flugmanöver verdrehen den Astronauten jedes Mal den Magen, wenn sie nicht gar tödlich enden.
Alles in allem wirken all diese Opfer wenig heldenhaft, sondern vielmehr selbstzerstörerisch. Die amerikanische Heldengeschichte der NASA wird so zur Leidensgeschichte einfacher Menschen. Aber es sind Menschen, die sich aktiv der Berufung eines Astronauten unterwerfen und dafür viel Leid hinnehmen.
Kritik und Zweifel am Sinn der Raumfahrt
Dieses menschliche Leid zieht sich durch den gesamten Film – bis es tatsächlich zur Mondlandung kommt. Doch wenn die vielen emotionalen Leiden der Astronauten und ihrer Angehörigen, die vielen Überwindungen körperlicher Grenzen, die Nahtod-Erlebnisse und tödlichen Unglücksfälle bei Tests und bemannten Flügen als unerträglich erscheinen, muss man sich fragen: Wieso machen die Leute das alles mit? Wieso geht Armstrong nicht einfach in die Frührente oder holt sich einen sichereren Job? Lange rätselt die ZuschauerInnenschaft.
Die Zuschauenden werden zudem immer wieder in ihren Zweifeln bestärkt: Armstrongs Frau, Janet Armstrong, fragt nach einem weiteren tödlichen Unfall von Kollegen ganz lapidar: „Wer diesmal?“. Überhaupt übernimmt sie die Rolle der Kritikerin und Zweiflerin. Irgendwann spricht sie davon, dass sie eine Weile „im Beerdigen richtig Routine“ hatten. Später sagt sie dem Direktor der NASA-Raumfahrermannschaften, Deke Slayton, direkt ins Gesicht: „All eure Vorschriften und Verfahren braucht ihr nur, damit es so aussieht, als hättet ihr alles unter Kontrolle. Ihr kommt mir vor wie pubertäre Jungs, die Flugzeugmodelle basteln. Ihr habt gar nichts unter Kontrolle!“
Die Frage des Fortschritts
In einer Szene wird der amerikanische Science Fiction-Autor Kurt Vonnegut in einem Fernsehauftritt dargestellt: „Wovon ich zum Beispiel träume, ist ein bewohnbares New York. Mir scheint, das wäre doch eine vernünftigere Verwendung unserer Steuern.“ Es folgen weitere kritische Stimmen seitens der Friedensbewegung und der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, die in den Raumfahrtmissionen keinen Sinn erkennen und sich vielmehr eine Lösung sozialer Probleme wünschen.
Wozu also der ganze Aufwand? Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond, kommentiert in der vorletzten Szene: „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein Riesensprung für die Menschheit.“ Aber die Inszenierung dieses „Riesensprungs“ ist keineswegs bombastisch oder phänomenal. Armstrong betritt erfolgreich den Mond. Aber es gibt keinerlei Jubel, und nicht einmal Freude ist in den Gesichtszügen des Astronauten zu sehen.
Die Motivation für die Astronauten und ihre Angehörigen ist nicht das Streben nach Glück oder Erfüllung. Denn der Beruf des Astronauten bedeutet Unglück. Die Motivation der Astronauten ist eine Maschinerie, die sie ihren irrationalen Anforderungen unterwirft und sie in “Zombies” verwandelt, wie eine Freundin von Janet Armstrong es sogar wortwörtlich ausdrückt. Armstrong ist als besonders erfolgreicher Pilot nur innerlich tot denkbar.
Der „Aufbruch zum Mond“ ist damit als eigentlich sinnloses, unvernünftiges Unterfangen beschrieben. Der „Riesensprung“ für die Menschheit erweist sich als kleiner Schritt, sowohl für Armstrong als auch für die Menschheit. Ein bedeutender Fortschritt ist er nicht. New York bewohnbar zu machen oder allen Menschen die gleichen Bürgerrechte zu gewähren, wäre wirklich weit sinnvoller gewesen. Der technische Fortschritt, den die NASA erzielen konnte, wird in dem Film als Bärendienst für die Menschheit entlarvt. Auch deswegen rief er seitens ultrareicher Republikaner und US-Nationalisten viel Kritik hervor. Ein guter Grund, um sich „Aufbruch zum Mond“ anzusehen.
[paypal_donation_button align=”left”]