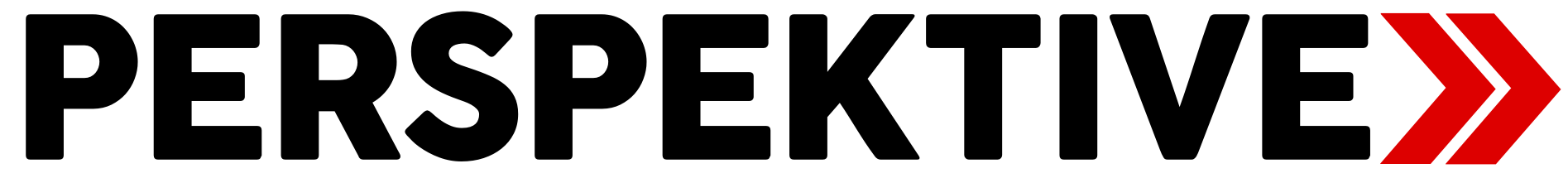Eine Auswertung des Statistischen Bundesamts (Destatis) zeigt: die Art, wie wir zusammenleben, hat sich in den letzten 75 Jahren stark verändert. Anfang der 50er lebte in etwa einem Fünftel der Haushalte nur eine Person, heute sind es knapp 40 Prozent. Was sagt dieser Trend über unsere Gesellschaft aus – werden wir immer einsamer? – Ein Kommentar von Tabea Karlo
Immer mehr Menschen leben allein, das zeigt die Auswertung des Mikrozensus zur Haushaltsgröße der letzten 50 Jahre. Im Jahr 1950 lebte in etwa einem Fünftel der Haushalte nur 1 Person. 2022 machten die sogenannten Single-Haushalte bereits rund 41% der 40,9 Millionen Haushalte aus.
Mikrozensus bedeutet im Übrigen „kleine Volkszählung“. Diese gesetzlich angeordnete statistische Erhebung wird jedes Jahr seit 1957 bei rund 1% der deutschen Bevölkerung durchgeführt. Aus ihr lassen sich dann Daten wie die Haushaltsgröße für ein Jahr statistisch verallgemeinert ablesen.
Konkret bedeuten diese Zahlen, dass 1950 rund 6% der Bevölkerung in einem Einzelhaushalt wohnten, im vergangenen Jahr lag dieser Anteil bei 20% – jede 5. Person in Deutschland lebt also allein.
Wer lebt wie?
Der klassische Großfamilienhaushalt, mit 5 Personen und mehr, war bereits 1950 auf dem Abstieg. Trotzdem machte er zu dieser Zeit mit rund 16% aller Haushalte noch einen vergleichsweise großen Teil aus. Heute hat sich die Großfamilie in Deutschland größtenteils überlebt, lediglich 4% aller Menschen wohnen in Haushalten mit 5 oder mehr Personen.
Darüber hinaus sind nicht alle, die Teil solcher Haushalte sind, Großfamilien. Teile sind eben auch studentische WG oder soziale Wohnprojekte. Insgesamt wohnen im deutschen Durchschnittshaushalt heute nur noch 2 Personen.
Wer lebt denn nun alleine?
In den letzten Jahren soll sich nicht nur die Anzahl der Menschen, die alleine wohnen, verändert haben, sondern durch zunehmende Scheidungen auch die Struktur dieser Haushalte. 1976 war ein Großteil der Alleinlebenden entweder verwitwet oder ledig, nur wenige waren geschieden oder getrennt lebend. Mittlerweile hat sich das verändert: Im Jahr 2022 machten ledige Alleinlebende zwar mit 51% die größte Gruppe aus, gefolgt wurde ihnen von Verwitweten, die etwa 25% der allein Lebenden ausmachten und schließlich geschiedenen Personen mit 19%.
Wer allein lebt, unterscheidet sich auch nach Alter: So leben mit 21,9% aller Männer zwischen 25 und 34 Jahren allein, bei den Frauen sind es nur 11,9%. Im Alter schwankt dieses Verhältnis zwar leicht, zeigt allerdings eine tendenzielle Abwärtsentwicklung bei den Männern und Steigerung bei den Frauen: So leben in der Altersgruppe zwischen 75 und 84 nur noch rund 7,4% der Männer allein, allerdings etwa 20,4% der Frauen. Das passt auch zu den Zahlen, dass Frauen insgesamt älter werden, und deshalb häufiger verwitwen.
Was bedeutet das für unsere Gesellschaft?
Letztlich bleibt die Frage, was man als Erkenntnis daraus ziehen möchte: Ist es automatisch tragisch, allein zu wohnen? Müssen wir mehr Verantwortung innerhalb der Familie übernehmen? Sollte man die Trennung noch einmal überdenken?
Der Anstieg der Single-Haushalte hat viele Gründe. Gesamtgesellschaftlich ist er allerdings das unvermeidbare Ergebnis des Zerfalls der Kleinfamilie im Kapitalismus und der Spaltung unserer Klasse in einzelne Individuen. Während die Scheidungsraten steigen, sieht man immer häufiger, wie sich Jugendliche und junge Erwachsene von ihren Familien lösen, und wie es darüber hinaus die jungen Menschen in die Städte treibt, während die Familien auf die Vorstädte und Speckgürtel der Großstädte verdrängt werden.
Das Problem ist also in erster Linie nicht die Tatsache, dass die Menschen allein wohnen, sondern was diese Tatsache aussagt und welche Einsamkeit sie reproduziert.
Das vor allem auf einer moralischen Ebene zu bewerten oder idealistisch aus seinem Kontext zu reißen, ergibt in der Realität wenig Sinn. Denn es sind nicht bloß die „Menschen, die ihre Beziehungen nicht mehr reparieren“ oder die „Jugendlichen, die keine Verantwortung mehr für die Familie übernehmen“ wollen. Vielmehr ist das die bloße Erscheinungsebene, während die Ursache in einer Gesellschaft liegt, die Einsamkeit faktisch hervorbringt.
Wir können die Verantwortung nicht bei jungen Menschen suchen, die in erdrückenden Familienverhältnissen groß werden und sich daraus lösen. Oder bei Frauen, die sich aus ihren patriarchalen Beziehungen entfernen. Denn für viele von ihnen bedeutet, allein zu wohnen vielleicht Einsamkeit, aber es bedeutet häufig eben erst einmal die Befreiung aus schlechteren Verhältnissen.
Darüber hinaus wachsen wir von Kind an in einer Gesellschaft auf, die uns beibringt, uns gegen andere durchzusetzen, die uns unsere Unterschiede statt unsere Gemeinsamkeiten als Klasse predigt. Natürlich zieht es dann viele Teile der Arbeiter:innenklasse nicht automatisch in gemeinsame Wohnungen, sondern der Individualismus überträgt sich in alle Lebensbereiche.
Für eine Alternative zur Einsamkeit
In einer von Konkurrenz geprägten Gesellschaft wie dem Kapitalismus lässt sich der Zerfall der zwischenmenschlichen Beziehungen nicht aufhalten, sondern lassen sich nur dessen Symptome bekämpfen – jedenfalls, solange man in diesen Grenzen denkt. Es ist allerdings an der Zeit, dass wir uns Gedanken machen, ob wir eine Gesellschaft, in der wir immer einsamer und unsere Beziehungen immer oberflächlicher und zerbrechlicher werden, wirklich wollen.
Wenn wir erkennen, dass es durchaus eine andere Option gibt, dann sind wir ganz und gar nicht aussichts- oder gar hoffnungslos. Eine Gesellschaft, wie der Sozialismus, die sich nach menschlichen Bedürfnissen richtet statt nach Kapitalinteressen, wird zweifellos weniger Konkurrenz, weniger Individualismus und folglich weniger Einsamkeit produzieren, da sie nicht von der Spaltung unserer Klasse profitiert – sondern im Gegenteil, diese ihr sogar schaden würde.
Wollen wir diese Gesellschaft erreichen, dann bedeutet das, dass wir uns bereits heute für sie einsetzen müssen. Es bedeutet, sich aktiv dafür stark zu machen, Vereinsamung zurückzudrängen – nicht, indem wir in Wohnverhältnissen bleiben, die uns schaden, sondern indem wir unsere Gemeinsamkeiten als Klasse erkennen und unsere Kämpfe gemeinsam führen.
Die Solidarität im Alltag leben
Im Kleinen bedeutet das, sich weniger darauf zu fokussieren, was uns trennt, sondern mehr darauf, was wir teilen. Vielleicht ist das Kind unserer Nachbar:innen oft sehr unruhig und quengelig. Aber ist das wirklich die Schuld der Nachbarsfamilie? Oder ist es nicht vielmehr so, dass die Eltern sich abarbeiten müssen, um eine Wohnung zu finanzieren, in der die Wände so dünn sind, dass man alles hört?
Oder, dass in der Nachbarschaft kaum Möglichkeiten bestehen, sein Kind zu beschäftigen? Wäre einem nicht mehr geholfen, wenn man sich austauschen würde? Wenn man bei der nächsten Nebenkostenabrechnung jemanden nebenan kennt, mit dem man sie vergleichen kann? Oder gemeinsam darüber nachdenkt, wie man die Schließung des Parks in der Nebenstraße verhindert?
Auch auf der Arbeit mag es Kolleg:innen geben, die weniger schnell arbeiten als man selbst oder mal Fehler machen. Aber ist das, was unseren Arbeitsalltag schwerer macht, wirklich die Arbeitsweise unsere Kolleg:innen? Oder ist es nicht eher die Tatsache, dass wir 40 Stunden die Woche arbeiten, darauf noch Überstunden kommen und der Lohn trotzdem nicht reicht? Wäre uns nicht mehr geholfen, wenn wir mit unseren Kolleg:innen über die unbezahlten Überstunden diskutierten? Oder darüber, dass letztes Jahr das Weihnachtsgeld gestrichen wurde?
In allen Teilen unseres Lebens spüren wir die Spaltung unserer Klasse und unsere zunehmende Vereinsamung. Dieser nur als Einzelpersonen entgegenzuwirken, ist anstrengend und scheint oft aussichtslos, aber das müssen wir auch nicht: Wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, dann bedeutet das für uns, nicht allein zu bleiben mit unseren Problemen, sondern uns über alle genau dort, wo wir gerade sind, mit den Menschen, die wir kennenlernen, zu verbinden. Sie wahrzunehmen als Teil unserer Klasse, gemeinsam gegen Probleme anzugehen und uns zu organisieren, statt der oder die Einzelkämpfer:in zu sein, die der Kapitalismus aus uns machen will.